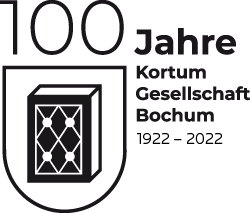Bochumer Gußstahlglocken.
Franz Eiermann.
Als der Waffenlärm des Weltkrieges verhallt war, fanden die Heimkehrenden das äußerliche Bild der vor der Kriegsfurie bis zu letzt beschirmten Heimat im wesentlichen unverändert vor: Feld und Wald, traute Gassen und altehrwürdige, liebgewonnene Bauten standen wie einst. Nur von den Türmen grüßte nicht mehr wie früher das volle Geläute mit heimatlichem, altgewohntem Klange, sondern aus verödeter Glockenstube erscholl fremd und wehmütig zugleich die Klage der von der einstigen klingenden Pracht noch übrig gebliebenen, vereinsamten Glockenstimmen um die geopferten Schwestern und die Not des Landes.
Mochte auch in der Volksseele durch die Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit manch seines, edles Klingen verstummt sein, so sprach doch der bald sich regende Wunsch, daß es von den Türmen in Freud und Leid wieder ertönen möge wie einst im Frieden, in sehr erfreulicher Weise für das fest verankerte, in langen Kriegsjahren erstarkte und vertiefte Heimatgefühl. Als dann aber die verarmten Gemeinden zur Zeit des beginnenden Wiederaufbaues die Erneuerung der Glocken ernstlich ins Auge fassen konnten, erwies sich zumeist der hohe Preis der früher üblichen Bronzeglocken als unerschwinglich. Die Bestandteile der Glockenbronze, einer rötlich-grauen, sehr spröden und schwer bearbeitbaren Legierung aus 75-78 v. Hundert Kupfer und 22-25 v. Hundert Zinn, waren im Inlande kaum noch und vom Auslande nur zu Preisen erhältlich, die ihre Verwendung meist von selbst verboten. Da erinnerte man sich, daß der Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, früher „Gußstahlfabrik“ von Mayer & Kühne, der bereits seit Jahrzehnten, und zwar bis 1915 als einziges Werk Europas, Glocken aus Gußstahl herstellte, und daß viele prächtige Geläute die Güte und Brauchbarkeit des Erzeugnisses bekundeten. Die Urteile der Sachverständigen waren dem Gußstahl als Glockenmaterial durchaus günstig, und man ging daher bald in großem Maßstabe daran, die fehlenden Glocken durch stählerne zu ersetzen.
Angesichts der bahnbrechenden und auch heute noch hochbedeutsamen Arbeit, welche demnach gerade in unserer engsten Heimat in der Pflege kultureller und heimatlicher Belange geleistet wurde und fortlaufend aufgewendet wird, sei an diesem Orte Herstellung und Wesen der Glocken allgemein sowie mit besonderer Berücksichtigung der Gußstahlglocken des Bochumer Vereins behandelt, eines Werkes, das den Namen unserer betriebsamen Stadt auf seinen Glocken bis in fernste Erdteile getragen hat. Leitend und Richtung gebend ist hierbei der Gedanke, daß das mit Recht in der Vergangenheit wurzelnde Heimatgefühl auch lebendige Fühlung halten muß mit den das heimatliche Bild prägenden Kräften der Gegenwart, in unserem Falle also der Industrie. Da die Liebe zu einer Sache um so tiefer zu sein pflegt, je gründlicher man sie kennt, so durfte die Darstellung dieses so bedeutungsvollen Ausschnittes aus dem gewerblichen Leben Bochums hier und da ein wenig ins einzelne gehen. –
Die alten Glockengießerfamilien, die oft viele Generationen hindurch ausschließlich Bronzeglocken gefertigt hatten, sahen sich nach dem Friedensschlusse durch die Geschäftslage vielfach gezwungen, zur Herstellung eiserner Glocken überzugehen, und auch manches Werk der Eisenindustrie nahm den Guß eiserner Glocken auf. Hierbei ergaben sich jedoch sogleich große Schwierigkeiten. Die bei dem um 800 Grad liegenden Schmelzpunkt der leichtflüssigen Glockenbronze ausreichenden, einfachen Oefen der Glockengießereien vermochten die zur Erzeugung der Gießtemperatur des Stahles erforderliche Hitze von über 1600 Grad nicht aufzubringen. Vielfach beschränkte man sich deshalb darauf, Gußeisen als Baustoff zu nehmen, das bei einem Schmelzpunkt von etwa 1200 Grad in verhältnismäßig einfachen Kupolöfen umgeschmolzen werden kann, während eine Anlage zum Stahlschmelzen eine sehr hochwertige, mit kostspieligen Nebenapparaten auszurüstende Ofenanlage erfordert. Angesichts der physikalischen Eigenschaften des Gußeisens, insbesondere seiner Sprödigkeit und geringen Festigkeit, war von vornherein weder hinsichtlich der klanglichen Eigenschaften noch hinsichtlich der Dauerhaftigkeit ein der Gußstahlglocke ebenbürtiges Erzeugnis zu erwarten, zumal gußeiserne Glocken bei gleicher Tonhöhe erheblich dickwandiger gegossen werden müssen als bronzene oder stählerne. Einige besonders findige, durch rechtliche Bedenken nicht gehemmte Firmen boten daher zur Hebung ihres Absatzes ihre Erzeugnisse als „Klangstahlglocken“, „Stahlglocken“ oder gar „Klangstahlglocken“ an, Bezeichnungen, die natürlich vollkommen unzulässig sind, da unter „Stahl“ nur gefrischtes Material, niemals aber Gußeisen verstanden werden kann. Derartige Benennungen waren selbstverständlich geeignet, den nicht Sachverständigen zu täuschen. Den wenigen Firmen aber, welche tatsächlich Gußstahlglocken herzustellen imstande waren, fehlten wiederum die in mehr als 70 Jahren vom Bochumer Verein in diesem von ihm mit besonderer Liebe gepflegten Betriebszweige gesammelten wertvollen Erfahrungen.
Hochwertige Gußstahlglocken herzustellen ist nämlich nicht so einfach, wie man sich das vielleicht im ersten Augenblick vorstellt. Der Bronzeglockenguß, der schon 2600 v. Chr. Den Aegyptern und Chinesen bekannt war, bot, wie man ja auch aus Schillers „Glocke“ weiß, technisch kaum erhebliche Schwierigkeiten. Ueber einem dem inneren Hohlraum der Glocke entsprechenden, in einer Grube aufgemauerten „Kern“, den man mit einer dünnen Talgschicht überzog, formte man die „falsche Glocke“, welche in ihrer Stärke und Gestalt der herzustellenden genau entsprach. Auf ihrer Außenseite brachte man Inschriften und Verzierungen aus Bienenwachs an. Nachdem auch die falsche Glocke mit einem Fettüberzug versehen war, umgab man sie mit einem Lehmmantel, der hierbei natürlich die auf der falschen Glocke angebrachten erhabenen Verzierungen und Inschriften als entsprechende Vertiefungen aufnahm. Setzte man das Ganze, was ohnehin des Trocknens halber geschehen mußte, der Hitze aus, so schmolz das Wachs, die Fettschichten gestatteten das Abheben des Mantels und nach Zertrümmerung der falschen Glocke die leichte Loslösung etwa noch anhaftender Stücke von dem stehenbleibenden Kern. Stülpte man über diesen genau in der gleichen Lage wie zuvor den Mantel, so verblieb zwischen Mantel und Kern ein Luftraum entsprechend der entfernten falschen Glocke. Stampfte man nun, damit der Mantel durch das Schmelzgut nicht gehoben wurde und dieses selbst auslief, die Grube mit Erde aus, so konnte der Einguß durch eine hierfür an der Krone vorgesehene Oeffnung erfolgen, wobei die Luft und die sich bildenden Gase und Dämpfe aus einer zweiten Oeffnung entwichen. Die Glocke wurde also stehend gegossen.
Bei der Leichtflüssigkeit der Bronze wurde die Form mit allen ihren feinen Einzelheiten meist restlos ausgefüllt, und auch die Erzielung blasenfreien Gusses machte kaum Schwierigkeiten. Fehlgüsse aus technischen Gründen waren daher verhältnismäßig selten. Da Schwindungserscheinungen, d. h. die Zusammenziehung bei der Erkaltung, bei der Bronze eine ziemlich untergeordnete Rolle spielen, das Gußstück der falschen Glocke also praktisch in der Form gleich war, so konnte man verlangen, daß die Tonhöhe nach dem Guß ohne eine die Gußhaut verletzende und daher innere Spannungen auslösende Nacharbeit der gewünschten entsprach. Diese Forderung führte allerdings namentlich bei der Herstellung größerer Geläute und Glockenspiele häufiger zu Fehlgüssen.
Wesentlich schwieriger und in verschiedenen Punkten vom Guß der Bronzeglocke abweichend, dessen Gefahren übrigens die Phantasie des Dichters etwas übertrieben schildern durfte, gestaltet sich der Arbeitsgang unter Verwendung des Gußstahles. Es liegt das schon in den erheblichen Unterschieden der stofflichen Eigenschaften, die hier unter Einbeziehung des Gußeisens und Zugrundelegung des vom Bochumer Vereins benutzten Gußstahles zusammengestellt sein mögen.
Die für die Festigkeitseigenschaften maßgebende Zerreißfestigkeit, d. i. die durch einen Draht von einem Quadratmillimeter Querschnitt beim Bruch aufgenommene Belastung, beträgt bei Gußeisen 12 kg und darüber Bronze 18-20, Gußstahl 70-80 kg/qmm.
Der für die elastischen Eigenschaften, also die Klangerzeugung, wichtige Elastizitätsmodul, d. i. die Kraft, welche theoretisch erforderlich wäre, um einen Stab von einem Quadratmillimeter Querschnitt unter elastischer Formänderung – wenn solche möglich wäre! – um seine eigene Länge zu dehnen, ergibt sich wie folgt: Gußeisen 7500, Bronze 10 400, Gußstahl 21 500 kg/qmm.
Die Schwindung, d. h. das Zusammenziehen beim Erkalten, zeigen folgende Zahlen: Gußeisen 1,04 v. Hundert, Bronze 1,54 v. Hundert, Gußstahl 2 v. Hundert.
Zeigen schon diese Zusammenstellungen eine erhebliche Ueberlegenheit gerade der für Klang und Festigkeit wichtigsten Konstanten zugunsten des Gußstahles, so wird dieser Eindruck noch verstärkt, wenn man bedenkt, daß Gußeisen und Bronze ihrer Sprödigkeit wegen zur Sprungbildung neigen, und daß Gußstahl infolge seiner erheblichen Naturhärte gegenüber Bronze eine wesentlich geringere, bei Benutzung eines bronzenen Klöppeleinsatzes überhaupt praktisch nicht feststellbare Abnutzung aufweist. Die Notwendigkeit andererseits, Stahlglocken mit einem rostsicheren Oelfarbenanstrich zu versehen, wird jeder gern in Kauf nehmen, wenn er erfährt, daß der auf das Kilogramm bezogene Preis von größeren Stahlglocken gegenüber Bronzeglocken gleicher Tonhöhe weniger als die Hälfte beträgt, und daß das geringere Gewicht bei größeren Stahlglocken weitere Ersparnisse auch bei der Konstruktion des Glockenstuhles nach sich zieht.
Die Unterschiede, welche sich aus der Verschiedenheit der Konstanten für die Herstellung selbst ergeben, liegen nicht allein in der Erhöhung der Gießtemperatur, welche in einem neuzeitlichen Stahlwerk z. B. im Siemens-Martinofen ohne Schwierigkeit zu erzielen ist, sondern sie beginnen schon mit der Gestaltung der „Rippe“. Unter Rippe versteht der Glockengießer die Schnittfläche, welche eine von der Glockenachse in beliebiger Richtung ausgehende Ebene mit dem Glockenkörper bildet. Bei einer vollen Drehung der Rippe um die Glockenachse wird also der Glockenkörper beschrieben. Je nach der verhältnismäßigen Breite der Schnittfigur, also je nach der Dicke der Glockenwandung, spricht man von starken, mittleren oder schwachen Rippen.
Die Konstruktion der Glocke geht von der Rippe aus. Letztere bestimmt im Zusammenhang mit Glockendurch-messer und Zusammensetzung des Schmelzgutes die Tonhöhe und im wesentlichen die sonstigen klanglichen Eigenschaften. Es ergibt sich hierbei die angesichts des verschiedenen Elastizitätsmoduls allerdings nicht weiter überraschende Tatsache, daß ein und dieselbe Glockenform, einmal in Bronze und einmal in Stahl ausgeführt, nicht die gleiche Tonhöhe entstehen läßt. Der Ton der Gußstahlglocke liegt vielmehr um etwa drei Halbtöne höher. Für den gleichen Ton muß eine Stahlglocke dementsprechend einen größeren Durchmesser erhalten. Dieser räumliche Nachteil wird aber durch den Umstand wettgemacht, daß durch die größere erregte Fläche eine größere Luftmasse erfaßt und damit die Tragweite und Fülle des Tones erhöht wird. Eine Vermehrung des Glockengewichtes ist mit der Vergrößerung des Durchmessers nur bei kleineren Glocken verbunden; bei größeren Glocken dagegen fällt das Gewicht sogar erheblich geringer aus, weil für die Herstellung in Gußstahl angesichts der bedeutend größeren Festigkeit eine wesentlich schwächere und klanglich günstigere Rippe gewählt werden kann.
Auch im Aufbau der Form ergeben sich kennzeichnende Unterschiede gegenüber dem für den Bronzeguß geschilderten Verfahren. Die durch die starke Schrumpfung der erkaltenden Stahlglocke entstehenden hohen Beanspruchungen bedingen eine entsprechende Ausgestaltung der Form. Der Kern wird über einem kräftigen, mit Rundeisen verstärkten Eisengerüst zunächst mit Hilfe einer um eine Achse drehbaren, der Innenseite der Rippe unter Berücksichtigung der Schwindung entsprechenden Schablone mit porösen Steinen roh aufgemauert, um alsdann mit grauem Mörtel beworfen und mittels Schablone genau geformt zu werden. Ein Graphitanstrich endlich verhindert später das Festbrennen des Mörtels am erkaltenden Stahl.
Gleichzeitig wird in einem glockenähnlichen, mit der Mündung aufwärts gerichteten, gußeisernen Formenmantel unter Benutzung einer zweiten, nunmehr der Außenform der späteren Glocke sinngemäß entsprechenden Schablone der Mantel hergestellt. Kern wie Mantel werden alsdann in großen, gichtgasbeheizten Kammern getrocknet, da zur Verhütung von stürmischer Dampfbildung oder gar von Explosionen, die den glühendflüssigen Inhalt aus der Form schleudern könnten, die Formmasse vollkommen trocken sein muß. Nachdem noch in dem getrockneten Mantel Inschriften und Verzierungen in vertiefter Spiegelschrift angebracht worden sind, wird der Mantel über den Kern gestülpt, so daß – immer unter Berücksichtigung der Schwindung – ein Hohlraum entsprechend der späteren Glocke überbleibt. Die Herstellung einer falschen Glocke kommt also hierbei ganz in Fortfall. Sind Mantel und Form kräftig miteinander verschraubt, so werden sie umgedreht, so daß der Glockenrand oben liegt. Eingußrichter und Steiger, letzterer für die entweichende Luft und zur Aufnahme der beim Guß emporsteigenden Verunreinigungen, münden nahe dem Rande auf der Innenseite. Sie sind sehr kräftig im Durchmesser gehalten, erkalten daher zuletzt und nehmen dabei den „Lunker“, der aus Gasaus-scheidungen und Verunreinigungen besteht, in sich auf.
Der Guß selbst, so fesselnd er beim erstmaligen Zuschauen erscheint, entbehrt, was auszusprechen vielleicht ernüchtert, durchaus Schillerscher Dramatik und ist ein in allen seinen Einzelheiten heute technisch vollkommen beherrschter Vorgang. Aus einem der für Stahlguß allgemein üblichen Siemens-Marinöfen, in dem ein vorzüglicher, sich möglichst blasenfrei vergießender Flußstahl erschmolzen wurde, empfängt eine schwere Kranpfanne eine Stahlmenge, die hinreicht, um damit mehrere Glocken zu gießen. Der Kran führt die Pfanne über die frei, also nicht etwa in einer Grube stehenden Formen, worauf mittels Handhebels das Bodenventil geöffnet wird. Sogleich fällt unter Funkensprühen ein hellorangefarbener Stahlstrahl von blendender Leuchtkraft in den Eingußrichter, wobei man aus dem Steiger die Luft entweichen hört, bis schließlich der in der Form immer höher steigende Stahl Steiger und Einguß anfüllt. In diesem Augenblick wird das Bodenventil der Kranpfanne geschlossen, und das Spiel wiederholt sich bei der nächsten Form.
Dem Abguß läßt man, damit inneren Spannungen vorgebeugt wird, einige Tage Zeit, sich an der Luft langsam abzukühlen. Dann werden Mantel und Kern entfernt, Steiger und Einguß abgeschnitten und etwa anhaftende Graphitreste beseitigt. Dem Abdrehen der Krone und Bohren der Löcher für die Aufhängeschrauben folgt die eine geübte Hand erfordernde und bereits in das Gebiet des Kunstgewerbes gehörende Ziselierung der Inschrift und Verzierungen in der Ziselierwerkstatt. Leider nämlich prägen sich diese infolge des immerhin zähflüssigeren Materials nicht mit der gleichen, wenig Nacharbeit erfordernden Schärfe wie beim Bronzeguß ab. Es bedarf vielmehr, soll das Werk den Meister loben, einer in müheseliger Kleinarbeit durchgeführten Herausbildung aller feineren Einzelheiten. Im übrigen lehnt man heute reichere Verzierungen als den Klang ungünstig beeinflussend ab. Die Inschrift der Stahlglocke, die ja aus einer neueren, dem Originellen wenig holden Zeit stammen, bestehen meist aus Bibelsprüchen oder Gesangbuchversen. Bemerkenswert sind in dieser Hinsicht vielleicht die Inschriften der Glocken der evangelischen Reinoldikirche in Dortmund. Sie lauten für die Hindenburgglocke: „Es streit` für uns der rechte Arm“, für die Kaiserglocke: „Das Reich muß uns doch bleiben“ und für die Lutherglocke: „Ein feste Burg ist unser Gott“.
Die weitere Bearbeitung vollzieht sich auf einer schweren Plandrehbank, wie sie nur in großen Werken anzutreffen ist, und jetzt erscheint alsbald die Behandlung der Glocke in ein Gebiet feinerer Geistigkeit gehoben; denn nun gibt es, die Seele der Glocke zu wecken, ihre Tonhöhe genau einzuregeln und ihr zunächst noch durch mancherlei Fehler entstelltes Klangbild läuternd zu gestalten. Der Klang einer Glocke nämlich ist ebenso wenig ein einheitlicher, durch eine einzige Schwingungszahl festlegbarer Ton wie etwa der Klang irgend eines anderen Musikinstrumentes. Der Hauptton erscheint vielmehr von einem Unter- und zahlreichen Obertönen umlagert, die an der unfertigen Glocke in sich bisweilen so unrein sind, daß an der Brauchbarkeit des Gußstückes gezweifelt werden kann. Hier setzt nun die mit besonders ersonnenen Stimmgabeln durchgeführte Klanganalyse ein. Es gilt hierbei, die Schwingungszahlen des Haupttones und seiner wichtigsten Nebentöne genau festzulegen. Zu diesem Zwecke stellt man mittels kleiner, auf den Schenkeln der Gabeln verschiebbarer Reiter zunächst den zu untersuchenden Ton nach dem Gehör roh ein, setzt den Gabelfuß außen auf den Glockenrand und wartet die Antwort der Glocke ab. Beginnt diese alsbald schwach zu tönen, so liegt die eingestellte Schwingungszahl der tatsächlichen bereits ziemlich nahe. Hat man durch wiederholtes Proben die Grenzen enger gezogen, so sind ganz geringe Abweichungen nur noch an den durch Interferenzerscheinungen verursachten Schwebungen zu erkennen.
Liegt nach Durchführung der Untersuchung das Klangbild in allen wissenswerten Einzelheiten fest, so beginnt die Feinarbeit der Einstimmung, wobei nach den Angaben des Bochumer Vereins nicht nur der mit dem Grundtone nicht ganz zusammenfallende Schlagton, sondern außer dem Grundton auch der als „Charakteristik“ besonders wichtige erste Oberton gestimmt werden kann. Letzterer verstärkt bei Gußstahlglocken den Unterton etwa in der Oktave; die Reinheit ihres Zusammenklanges ist also von besonderer Bedeutung und läßt die für Stahlglocken charakteristische ausgesprochene Zweistimmigkeit in edler Ausprägung hervortreten. Und zwar liegt der Unterton etwa eine große Sexte unter dem Grundton, während der erste Oberton etwa eine kleine Terz darüber liegt. Auf diese akustischen Beziehungen hat der Entwurf eines Geläutes Rücksicht zu nehmen. Man gesellt daher dem Grundton eines Dreiklanges gern die kleine Terz und die verminderte Quinte bei, gibt damit also dem Geläute Mollcharakter.
Haben die einzelnen Glocken nach ihrer Vollendung Gnade vor den Ohren des meist vom Besteller ernannten Glockensachverständigen gefunden, und ist, falls ein größeres Geläute zu liefern war, auch das Probeläuten, welches die Einrichtungen des Bochumer Vereins für bis zu 12 Glocken gleichzeitig gestatten, im Zusammenklang zur Zufriedenheit ausgefallen, so können die Glocken das Werktor verlassen und ihre festliche Fahrt nach der Stätte ihrer Bestimmung antreten. Dort schreitet man bei katholischen Kirchen zu einem feierlichen Weiheakt, zur Glockentaufe, während die evangelische Kirche diesen Brauch nicht aufgenommen hat und es beim Einläuten neuer Glocken mit einer festlichen „Glockenpredigt“ bewenden läßt. Nach einer kurzen Reise durch die Luft, findet das Geläute seinen endgültigen Platz in den Stühlen der Glockenstube, und es bedarf jetzt nur noch der Einhängung des Klöppels.
Bekanntlich wird zum Läuten der Glocken in der Regel nicht der Klöppel angetrieben, sondern die Glocke. Im andern Falle würde die Glocke stillstehen und dem Klange das Leben fehlen, das erst die schwingende Bewegung dem Tone verleiht. Wird hingegen die Glocke angetrieben, so muß der Klöppel etwa in dem Augenblick anschlagen, in dem die ausschwingende Glocke ihre höchste Lage erreicht hat. Auch soll der Klöppel den Schlagring der Glocke nicht mit hartem Schlage treffen, sondern ihn nur „küssen“. Da ferner Stahl auf Stahl einen unschönen Klang ergibt, so tragen die Klöppel in einer schwach kegelförmigen Bohrung einen Anschlagbolzen aus Bronze.
Mit der sachgemäßen Einhängung der Klöppel gewinnt somit die Aufstellung der Glocken ihren Abschluß und das neue Geläute kann nun in Erfüllung seiner hohen und ehrwürdigen Aufgaben eine unabsehbare Reihe von Jahrhunderten hindurch weithin seinen Ruf erschallen lassen und wird mit seinen Klängen zu einem wesentlichen Bestandteile des heimatlichen Bildes.
Es liegen die Fragen nahe, wie sich Gußstahlglocken im Vergleich mit Bronzegeläuten im praktischen Gebrauch bewähren, welche Beurteilung ihre klanglichen Eigenschaften finden, und endlich, welche Ausbreitung der Gebrauch stählerner Glocken bereits gefunden hat.
Die erste Frage ist bald beantwortet. Das an sich zweifellos als Mangel anzusprechende Abrosten verwahrloster Glocken besitzt nicht die ihm meist zugemessene übertriebene Bedeutung. Auch eine ziemlich dicke Rostschicht enthält aus chemischen Gründen nur eine recht bescheidene Menge Eisen und wird daher den Klang in merkbaren Grenzen nicht beeinflussen. Im übrigen ist der Rostgefahr durch Erneuerung des Oelanstriches in etwa fünfjährigen Zwischenräumen mit Kosten vorzubeugen, die nur einen bescheidenen Bruchteil dessen bilden, was im gleichen Zeitraume die Verzinsung der Mehrkosten einer Bronzeglocke ausmacht. Diese Mehrkosten sind sehr erheblich und betragen bei größeren Glocken mehrere tausend Mark. Aber auch vom Standpunkt der Haltbarkeit ist die Stahlglocke weit überlegen. Während alljährlich eine große Anzahl von Bronzeglocken springt und umgeschmolzen oder in kostspieliger Arbeit nach besonderem Verfahren ausgebessert werden muß, ist bisher noch kein Fall des Springens von Stahlglocken bekannt geworden, was bei den weit überragenden Festigkeitseigenschaften des Gußstahles leicht zu erklären ist. Aus eben diesem Grunde ist auch die Abnutzung der naturharten Stahlglocken bei Gebrauch bronzener Klöppelbolzen so gering, daß nach menschlicher Voraussicht ein Ersatz wegen Abnutzung kaum jemals vorkommen wird, während Bronzeglocken verhältnismäßig bald eine merkbare Formänderung an der Anschlagstelle zeigen und nach mehrfachem Umhängen wegen allgemeiner Schwäche des Schlagringes bereits nach etwa drei Jahrhunderten zugrunde gehen. Für die größere Lebensdauer der Stahlglocke kann noch ein anderer Umstand ins Feld geführt werden. Angesichts der Häufigkeit von Turmbränden ist die Bronzeglocke ihres niedrigen Schmelzpunktes wegen erhöhter Gefährdung ausgesetzt und wird zumeist ein Opfer der Flammen werden oder beim Niederfallen zerspringen. Stahlglocken dagegen erliegen erfahrungsgemäß ihres hohen Schmelzpunktes wegen der Hitze nicht und überstehen im allgemeinen nach dem Zusammenbruche des Glockenstuhles den Fall in die Tiefe unversehrt. So fand man häufig , z. B. nach dem Brande der Berliner Garnisonkirche, das abgestürzte Geläute wohlbehalten unter den Trümmern vor.
Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit kann man also den Stahlglocken den „Ersatz“-Charakter im Sinne der Kriegs- und Nachkriegszeit keinesfalls unterschieben, wiewohl es an Versuchen dazu begreiflicherweise nicht gefehlt hat. Wie aber steht es um die Verwertung des Klanges?
Fülle und Reichweite der Stahlglocke sind schon mit Rücksicht auf die vergrößerte Mensur bei gleicher Tonhöhe überlegen. Bei der Beurteilung des Klangcharakters nach seinem musikalischen Werte müssen selbstverständlich persönliche Geschmacksrichtungen möglichst ausgeschaltet werden, und man besitzt glücklicherweise in der mit wissenschaftlicher Zuverlässigkeit und Genauigkeit durchgeführten Klanganalyse eine sehr sachliche und unanfechtbare Grundlage für die Beurteilung des musikalischen Wertes. Zahl, Gruppierung, Stärke und Reinheit der wichtigen Nebentöne, in ihrem Zusammenwirken für Farbe und Charakter des Tones bestimmend, sind sachkundiger Messung zugänglich.
Die aus einem sehr umfangreichen Untersuchungsmaterial gewonnenen Ergebnisse haben einen hervorragenden Glockensachverständigen in klanglicher Beziehung zu dem Urteil geführt, daß in der höheren Tonlage der Bronzeglocke der Vorzug zu geben ist, während in den mittleren Lagen Gleichwertigkeit besteht, und daß in der Tiefe, also bei größeren Glocken, Gußstahl überlegen ist. Nicht minder günstig lauten gutachtliche Aueßerungen zahlreicher anderer Sachverständiger.
Man darf sich dieser Beurteilung vom heimatlichen Standpunkt aus freuen, berechtigt sie doch zu der zuversichtlichen Hoffnung, daß die Eigenart der einem Riesenwerke unserer Eisenindustrie seltsam angegliederten kunstgewerblichen Glockenabteilung auch in der Zukunft mit günstigem wirtschaftlichen Ergebnis erhalten bleibt. Dies darf um so mehr erwartet werden, als der zur Bearbeitung der Gußstücke zur Verfügung stehenden Park schwerer und kostspieliger Werkzeugmaschinen dem Wettbewerbe wohl kaum in ähnlichem Ausmaße zu eigen sein dürfte.
Mit seinen ersten Erfolgen erscheint der Stahlglockenguß in werkgeschichtlicher Beziehung bereits an die Erfindung des Stahlformgusses geknüpft, die 1847 dem damaligen technischen Direktor des Bochumer Vereins, Jakob Mayer, gelang; und zwar stellten Gußstahlglocken die ersten wohlgelungenen Früchte dieser neuen und höchst bedeutungsvollen Errungenschaft dar. Der Erstling dieser Erzeugung war bereits gelegentlich einer Düsseldorfer Ausstellung Gegenstand allgemeiner Bewunderung, und auf der Pariser Internationalen Ausstellung 1855 kannte das Staunen der Fachwelt keine Grenzen. Alfred Krupp, selbst doch gewiß Fachmann in der Gußstahlerzeugung, stellte die Möglichkeit der Abformung in so zähflüssigem Material sogar in Abrede und mußte sich durch eine Schmiede- und Härteprobe, welche Mayer an Stücken einer zu diesem Zwecke zerschlagenen Glocke vor den Augen der Preisrichter vornehmen ließ, von Gegenteil überzeugen.
Seitdem haben über 30 000 Kirchenglocken das Bochumer Werk verlassen, und wenn auch die Hochflutwelle der nachkriegszeitlichen Glockenerzeugung verebbt ist, so stellen die im Durchschnitt auch heute noch monatlich gegossenen etwa 30 Glocken einen recht ansehnlichen Absatz dar, zumal größere Kirchenglocken nicht als Massenware gelten können. Längst hat die Güte dieser Stahlglocken sich Weltgeltung zu schaffen gewußt, und so senden denn Bochumer Geläute ihre schwingenden, wogenden Klänge nicht nur von ungezählten Glockentürmen in deutschen Landen, sondern auch weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus ertönt in allen Erteilen, in Petersburg, Hammerfest, Tsingtau, Kapstadt, Newyork, Loxton und zahllosen anderen Städten, oft mit Aufschriften in fremder Zunge geziert, die ernste Pracht der Bochumer Gußstahlglocke, Gott zu Preis und Ehre, dem Meister zum Lobe, der kunstreich ihre klingende Seele läuterte, und deutscher Arbeit zum Ruhme.
(ohne Jahr, ca. 1928) Bochum Heimatbuch
Herausgegeben im Auftrag der Vereinigung für Heimatkunde von B. Kleff.
Verlag und Druck
Schürmann & Klagge
1. Band
An diesem Heimatbuche arbeiteten mit:
Staatsanwaltschaftsrat Dr. G. Höfken
Bergassessor Dr. P. Kukuk, Privatdozent an der Universität Münster
Rektor B. Kleff, Leiter des Städtischen Museums
Redakteur A. Peddinghaus
Redakteur F. Pierenkämper
Lehrer J. Sternemann
Studienrat Dr. G. Wefelscheid
Gustav Singerhoff
Wilma Weierhorn
sämtlich in Bochum
Die Federzeichnungen besorgte Graphiker Ewald Forzig
die Scherenschnitte Frl. E. Marrè / die Baumphotographien Ingenieur Aug. Nihuus
den übrigen Buchschmuck Druckereileiter Erich Brockmann
sämtlich in Bochum
(Zitierhinweis 2012)
Bernhard Kleff, Hg.: Bochum. Ein Heimatbuch. Bochum 1925. Bochumer Heimatbuch Bd. 1