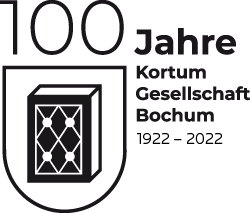Die Stadt Bochum –
ihr Weg zur modernen Groß- und Universitätsstadt.
Helmut Croon
Als amerkanische Truppen am 10. April 1945 Bochum besetzten, war die Stadt durch die Luftangriffe der letzten Kriegsjahre weitgehend zerstört. Von 93 699 Wohnungen waren nur 10 501 unbeschädigt geblieben. In den Trümmern lebten noch 161 590 Menschen, 1939 waren es 312 933 gewesen. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt waren bedroht. Die großen Werkanlagen des Bochumer Vereins, der Edelstahlwerke und anderer Unternehmen standen auf der Demontageliste; ihre Werktore blieben geschlossen. Nur der Bergbau in den Vororten bot Arbeitsmöglichkeiten. Dennoch waren die Bochumer zum Wiederaufbau ihrer Stadt, mit der sie sich verbunden fühlten, zu deren Geschichte sie sich bekannten, entschlossen. Sie taten es in dem Bewußtsein, daß in gemeinsamer Arbeit die Grundlagen für ein neues Leben in der Stadt geschaffen werden könnte. Daß zwanzig Jahre später das wiedererstandene Bochum als Universitätsstadt vor neuen Aufgaben stehen sollte, konnten sie nicht ahnen, gleichwie ein Jahrhundert zuvor die Bochumer die Entwicklung ihrer kleinen Stadt zur Industriegroßstadt nicht voraussehen konnten.
Als 1816 der räumlich weit ausgedehnte, von der Emscher im Norden bis zu den ersten Höhenzügen des Bergischen Landes im Süden sich erstreckende Kreis Bochum gebildet wurde, hatte Bochum nur 2107 Einwohner. Nur an wenigen Stellen war die Stadt über ihren kleinen mittelalterlichen Kern hinausgewachsen. Von den öffentlichen Gebäuden und einigen Bürgerhäusern abgesehen, gab es in den engen Straßen nur Fachwerkhaüser. Die Feldmark nahm den größten Teil des Stadtgebietes ein. In ihr hatten die Bürger ihre Gärten und Felder. Feldwege und schlechte Straßen führten zu den Nachbarorten; durch die 1789/91 gebaute feste Landstraße nach Witten war Bochum mit dem aufblühenden Wirtschaftsgebiet der südlichen Mark verbunden. Die Landwirtschaft bildete den Haupterwerb für die Dörfer und Bauernschaften des Kreises. Nur im Süden des heutigen Stadtgebietes an der Ruhr und in ihren Seitentälern bis zur Wasserscheide von Ruhr und Emscher wurde Bergbau betrieben. Bochum war nicht nur der wirtschaftliche Mittelpunkt und Marktort für die umliegenden Dörfer, sondern auch der kirchliche. Unverändert geblieben war der Sprengel der katholischen Petri- und Paulskirche, eine der Urpfarrkirchen am westfälischen Hellweg; er umfaßte fast das gesamte heutige Stadtgebiet. Praktisch begrenzt war er aber dadurch daß die Filiakirchen im Süden und Osten der Stadt seit der Reformation evangelisch waren. Evangelisch geworden war auch die Kirche in Stiepel, deren erstes Gebäude kurz nach dem Jahre 1008 errichtet worden war; ihre wiederentdeckten Wandmalereien aus der romanischen Zeit gehören zu den ältesten in Westfalen. Die evangelischen Gemeinden im nördlichen Teil de Kreises waren in der Synode Bochum vereinigt. Für das Leben in der Ländlichen Kreisstadt war von Bedeutung, daß nicht nur das Stadt- und Landgericht für den Kreis seinen Sitz in ihr hatte, sondern auch das für den westfälischen Teil des Ruhrgebietes zuständige märkische Bergamt und das mit ihm verbundene Berggericht. Die zahlreichen Beamten und Richter dieser Behörden nehmen zusammen mit den wenigen Angehörigen freier Berufe – Anwälten und Ärzten – sowie einigen angesehenen Kaufleuten die erste Stellung im gesellschaftlichen Leben der Stadt ein. Ein Gymnasium oder Progymnasium wie in den benachbarten Kreisstädten gab es in Bochum und dem gesamten Kreis nicht. In der Bürgergesellschaft der “Harmonie” und in der Loge trafen sich die Honoratioren der Stadt mit den adeligen und bürgerlichen Gutsbesitzern der Umgebung. Seit 1829 erschien in Bochum, wenn zunächst auch nur wöchentlich, eine Zeitung; aus ihr ging 1849 der “Märkische Sprecher”, das amtliche Kreisblatt, hervor.
Dank der günstigen Absatzmöglichkeiten auf der schiffbaren Ruhr nahm die Förderung der Zechen seit den 30er Jahren zu. Die Einwohnerzahl der Gemeinden im Süden der Stadt wuchs; die ersten größeren Ansiedlungen für Bergleute entstanden. Das Landschaftsbild änderte sich aber dadurch nicht. “Ackerbau und Bergbau waren auf das glücklichste verschwistert”, wie H. L. Jacobi 1856 schrieb. Bochum nahm an diesem wirtschaftlichen Wachstum teil, insbesondere seit dem Bau der Landstraße von Hattingen nach Recklinghausen, die seit 1842 das Bergische Land mit dem Münsterland verband. Obwohl sich auch seine Einwohnerzahl von 1818 bis 1843 verdoppelte, blieb sein kleinstädtischer Charakter gewahrt. Nur widerstrebend fügten sich 1843 die Bochumer der Anordnung der Regierung und führten die Städteordnung ein. Ihnen erschien die finanzielle Belastung, die sich durch die Trennung der städtischen Verwaltung von der der Landgemeinden ergab, zu groß. Vergebens wiesen sie darauf hin, daß sich nicht genügend geeignete Bürger finden würden, die bereit seien, ein Ehrenamt zu übernehmen.
Mit den 40er Jahren begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte Bochums und seiner Vororte. 1841 wurden unmittelbar an der Bochumer Stadtgrenze im benachbartem Hamme beim Abteufen der Schachtanlage Präsident das erste Kohlenflöz unter der Mergeldecke erschlossen. 1844 konnte die Zeche, die erste Tiefbauzeche im westfälischen Teil des Ruhrgebietes, mit der Förderung beginnen. Ein Jahr zuvor hatte Jacob Mayer, der geniale schwäbische Mechaniker und Erfinder, westlich der Stadt an der Essener Chaussee Gelände erworben, und nach seinen Plänen eine Gußstahlfabrik errichtet, die 1844 in Betrieb genommen wurde. In wenigen Jahren wurden sie zum größten Unternehmen der Stadt. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen Jacob Mayer dazu, sein Werk in andere Hände zu legen. 1854 wurde mit Hilfe von Kölner Bankleuten der Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation gegründet. Die technische Leitung verblieb Jacob Mayer, auf dessen technisches Können und Erfindungsgeist man nicht verzichten wollte und konnte. Als kaufmännischer Direktor wurde Louis Baare berufen. Unter seiner Leitung wurde der Bochumer Verein zu einem der führenden Unternehmen des Ruhrgebietes dessen Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten das Werden der Stadt weitgehend beeinflußte. Der Bergbau hielt gleichzeitig seinen Einzug in den ländlichen Gemeinden im Norden und Osten der Stadt. Ende der 40er und zu Beginn der 50er Jahre wurden die ersten Schachtanlagen der heute noch bestehenden Bergwerksgesellschaft abgeteuft: Hannibal und Constantin der Große und Hofstede, Hannover in Hordel. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre begann die Harpener Bergbaugesellschaft mit dem Abteufen ihrer ersten Schächte in Werne. Ungünstig wirkte sich zunächst aus, daß Bochum und seine Vororte abseits der Köln-Mindener Bahn, die durch das Emschertal gebaut wurde, lagen. Erst 1860 wurde Bochum durch die Eröffnung der Eisenbahnlinie Witten-Langendreer-Bochum unmittelbar an das wachsende rheinisch-westfälische Eisenbahnnetz angeschlossen; zwei Jahre später waren die Eisenbahnstrecken nach Essen und Dortmund vollendet. Der Eisenbahnverkehr von Westen nach Osten führte nicht mehr an der Stadt vorbei. Nachteilig blieb jedoch, daß die wenigen, in den folgenden Jahrzehnten gebauten Nord-Süd-Verbindungen vornehmlich industriellen Zwecken dienten . Die Städte und aufstrebenden Industriegemeinde im Süden und vor allem im Norden des Kreises richteten sich infolgedessen in ihren Verkehrsbeziehungen stärker nach Essen und Dortmund als zur Kreisstadt hin aus. Die Entwicklung Bochums in den ersten Jahrzehnten des industriellen Werdens wurde in entscheidender Weise geprägt durch den Mann, den die Bochumer Stadtverordneten 1843 zum Bürgermeister ihrer Stadt gewählt hatten: Max Greve. Vom ersten tage seines Wirkens war sein Bestreben, die ihm anvertraute Stadt zum wirklichen Mittelpunkt des Kreises zu machen. Seinen Bemühungen war es vornehmlich zu verdanken, daß Bochum endlich, wenn auch verspätet, Anschluß an das Eisenbahnnetz erhielt. Maßgebend war er an der Gründung der Handelskammer in Bochum beteiligt. Er war ihr erster Sekretär. Ihr gehörten zunächst nur Kaufleute und Fabrikanten aus Bochum, Hattingen und Witten an. Erst, als seit 1872 auch die Bergwerksgesellschaften Mitglieder wählen konnten, wurde sie zur Vertretung von Industrie, Handel und Gewerbe des gesamten Kreises. Ihr Bereich änderte sich auch nicht als 1885 die Kreise Hattingen und Gelsenkirchen vom Landkreis Bochum abgetrennt wurden. Mit dem Bau der städtischen Gasanstalt 1855, der ersten im westfälischen Teil des Ruhrgebietes, und des Wasserwerkes 1871 schuf er die Grundlagen für die heutigen Stadtwerke. Eine Sparkasse, heute Städtische Sparkasse in einem der markantesten Gebäude untergebracht, war als Institut der Selbsthilfe bereits vor seinem Dienstantritt gegründet worden.
Greves besondere Bemühungen galten dem Ausbau des Schulwesens; die geistige Entwicklung der Stadt sollte mit der materiellen gleichen Schritt halten. Bochum hatte zwar gute Volksschulen. Die 1816 gegründete Bergschule hatte dank ihrer ausgezeichneten Lehrer, zumeist Beamte des märkischen Bergamtes, einen guten Ruf. Es fehlte aber eine allgemeinbildende höhere Schule. Die durch Vereinigung der beiden kirchlichen Rektoratsschulen zu schaffen, wie es der erste Plan Greves war, scheiterte an unüberwindbaren kirchlichen Widerständen. Da die noch kleine Stadt auf staatliches Zuschüsse bei der Verwirklichung ihres Vorhabens angewiesen war, kam es 1851 zur Gründung einer Provinzialgewerbeschule, die wie alle Schulen dieser Art ihre Schüler für den Eintritt in das Berufsleben als selbständige Handwerker und Gewerbetreibende ausbildete oder zum Besuch des “Technischen Institutes” in Berlin vorbereitete. Sie entsprach damit den Belangen der Industrie, vieler Gewerbetreibender, die ihren Söhnen eine vertiefte Ausbildung für das praktische Leben geben wollten, nicht aber den Wünschen des ständig größer werdenden Kreises von Angehörigen akademischer Berufe. Das ihre Söhne die Möglichkeit hatten, in Bochum selbst die Berechtigung zum Studium an einer Universität zu erlangen, lag auch im Sinne der Stadt. Die 1860 gegründete Bürgerschule, als Realschule mit gymnasialen Klassen geplant, wurde zum Gymnasium ausgebaut und 1910 vom Staat übernommen. Die Provinzial-gewerbeschule, deren Auflösung beabsichtigt war, zumal die Zahl der Schüler aus der Stadt gering war, blieb aber, vom Kreis vornehmlich finanziert, zunächst bestehen. Verwaltungsmäßig getrennt, aber durch eine gemeinsame Leitung mit ihr verbunden, bestand seit dem Herbst 1871 eine städtische Gewerbevorschule. Aus beiden ging nach mannigfachen organisatorischen und lehrplanmäßigen Änderungen in den 70er und 80er Jahren eine Oberrealschule, die heutige Goetheschule, hervor Für die Mädchen bestanden seit den 60er Jahren zwei private höhere Töchterschulen, die heutige Freiherr-vom-Stein-Schule, gegründet 1965, und die seit 1923 staatliche, 1860 gegründete Hildegardisschule. Die ersten Anfänge der heutigen Berufsschulen gehen gleichfalls auf Anregung Greves zurück. Der Provinzialgewerbeschule wurde bei der Gründung eine Handwerker-fortbildungsschule angegliedert, deren Unterricht in den Abendstunden und sonntags abgehalten wurde. Die Grundlagen für die weiterführenden Schulen hatte Greve damit geschaffen, die Auswirkungen ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit zeigten sich jedoch erst später. Als Greve 1873 starb, war Bochum aus einer ländlichen Kreisstadt zu einer aufstrebenden Industriestadt geworden, deren Name durch die Erzeugnisse des Bochumer Vereins weithin bekannt war. Der Kuhhirt trieb nicht mehr die Kühe und Ziegen auf die Weide. Aus der Viehweide wurde der Stadtpark, ein Ausflugsziel und eine Stätte der Erholung für die ständig wachsende Bevölkerung. 1873 wohnten 25 174 Menschen in der Stadt, 1843 waren es nur 4282 gewesen.
Die Zunahme war eine Folge der starken Zuwanderung. Hatten in den 50er Jahren die Arbeiter des Bochumer Vereins und der benachbarten Zechen nur von Frühjahr bis Herbst in Bochum gearbeitet, den Winter in ihrer Heimat verbracht, so wurden sie seit den 60er Jahren heimisch. Manche Bochumer hatten den Bau und die ständige Vergrößerung der Gußstahlfabrik mit einem gewissen Mißtrauen beobachtet, wenn sie auch die Bedeutung des Werkes anerkennen mußten. Obwohl die Zuwanderer zum größten Teil Westfalen waren, blieb eine gewisse Abneigung gegen die Fremden in einzelnen Kreisen der Bürgerschaft lange bestehen.
Dazu trug bei, daß die neuen Bürger außerhalb des alten Stadtkerns, dem Wohnbereich der altansässigen Bochumer – Handwerker, Händler und Kleingewerbetreibende – lebten. Die Zugewanderten der gehobenen und mittleren Kreise, Beamte, Angehörige freier Berufe, Ingenieure, Bauunternehmer, wohnten vornehmlich in den neuen Straßen, die in den 50er und 60er Jahren im Süden und Südwesten der Altstadt angelegt worden waren. In unmittelbarer Nähe seiner Werkanlagen baute der Bochumer Verein Wohnungen für seine Ingenieure, Werkmeister, kaufmännischen Angestellten, die “Fabrikbeamten”, wie sie sich nannten. Die große Kolonie Stahlhausen, deren erste Häuser 1864 errichtet wurden, lag weit vom Stadtzentrum entfernt an der westlichen Grenze des Stadtgebietes. Baulich wuchsen zwar der Wohnbereich des Bochumer Vereins und die sich ausdehnende Stadt zusammen, als zu Beginn der 70er Jahre Bauunternehmer, Kaufleute und Handwerksmeister im Griesenbruch ein ausgedehntes Wohnviertel mit mehrstöckigen Häusern für die Arbeiter des Bochumer Vereins schufen. Die Gußstahlbahn, die diesen neuen Stadtteil von der übrigen Stadt schied, war zugleich aber auch eine deutliche gesellschaftliche Scheide zwischen dem Wohnbereich der Angestellten und Arbeiter des Bochumer Vereins und dem der alten und neuen Bürger der Stadt. Es waren zwei verschiedene Welten, zwischen denen es nur wenige menschliche Verbindungen gab.
Die Krise nach den Gründerjahren hemmte für mehr als ein Jahrzehnt die weitere Entwicklung der Stadt. Erst zu Beginn der 80er Jahre setzte ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung ein.
Die Einwohnerzahl stieg von 32 000 im Jahre 1880 auf mehr als 65 000 im Jahre 1900. Das Bochum dieser Jahrzehnte war eine Stadt der Arbeit. Arbeiter vor allem die “Fabriker” des Bochumer Vereins und der Bergleute bildeten seit den 60er Jahren den Hauptteil der Bevölkerung. Fremd in die Stadt gekommen, war es ihr Bestreben, ein Heim zu gründen. Die Sorge für den Unterhalt ihrer kinderreichen Familien nahm den größten Teil ihrer Zeit in Anspruch. Nach der schweren Arbeit genügte es ihnen, sich zerstreuen zu können. Bestimmt wurde das Geschehen in der Stadt durch den Bochumer Verein. Er war der wichtigste Steuerzahler, der größte Arbeitgeber. Unmittelbar und mittelbar waren von ihm zahlreiche Gewerbetreibende, Kaufleute, Händler, Handwerker, abhängig. Rückschläge und Erfolge des Unternehmens wirkten sich auf das gesamte wirtschaftliche Leben in der Stadt aus. Wenn auch der Bochumer Verein nicht wie die Zechen in den Vororten auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen einziger Wähler in der ersten Abteilung war, nicht wie diese ein Drittel der Stadtverordneten ernennen konnte, so war doch sein Einfluß auf die Verwaltung der Stadt groß. Louis Baare, ein Unternehmer von Namen und Rang, der Berater Bismarcks in den Fragen der Sozialpolitik, war einer der maßgebenden, vielleicht der allein bestimmende Mann der Stadt. Von 1872 bis zu seinem Tode 1897 war er Präsident der Handelskammer, von 1863 bis 1897 Stadtverordneter. Stadtverordnete waren gleich ihm leitende Angestellte des Bochumer Vereins, die Direktoren der großen Zechengesellschaften, die in der Stadt ihren Sitz hatten, Fabrikanten, die auf eine enge Zusammenarbeit mit der Schwerindustrie angewiesen waren, Anwälte, die ihr beruflich nahestanden. Gegen die Vorherrschaft der “Hüttenpartei” hatten sich bei den Stadtverordneten-wahlen der 70er und 80er Jahre die altansässigen Bochumer, der selbständige gewerbliche Mittelstand, mit geringem Erfolg gewehrt, wenn sie auch nicht völlig ausgeschaltet wurden. Für die innere Entwicklung der Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war von Bedeutung, daß nicht nur die leitenden Männer des Bochumer Vereins, die Bergwerksdirektoren, sondern auch die Inhaber der mittleren industriellen Unternehmen, die seit den 60er Jahren gegründet wurden, nicht aus altansässigen Bochumer Familien stammten, sondern erst im Zuge der industriellen Entwicklung in die Stadt gekommen waren. Wohl hatten sich Bochumer in den 50er Jahren als Gewerken an Bergwerksgründungen beteiligt, einige im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Stadt bis zum Beginn der 60er Jahre eine maßgebende Stellung eingenommen: Der industriellen Führungsschicht, die sich seit den 60er Jahren um Louis Baare bildete und das politische, wirt-schaftliche Leben der Stadt maßgebend bestimmte, gehörte zunächst kein Bochumer an. Mit der Stadt, in der sie lebten, fühlten sich diese Männer der Industrie nicht innerlich verbunden. Ihre Arbeit galt dem Unternehmen, das sie leiteten, in dem sie wirkten. Zur Beschäftigung mit Kunst fehlte ihnen die Zeit, aber auch zumeist die Neigung. Die ungeahnten Möglichkeiten der technischen Entwicklung in ihrer Zeit erfüllten sie ganz.
Wie weit die Belange des Unternehmens oder das in ihrer Generation noch lebendige Gefühl der Verpflichtung zu ehrenamtlicher Tätigkeit sie veranlaßte, im Dienst der Stadt wie auch der Kirchengemeinden sich zu betätigen, ist im einzelnen schwer zu entscheiden. Es genügte ihnen, die materiellen Voraussetzungen städtischen Lebens durch Bau von Straßen, von Wasser- und Gaswerken, durch Kanalisation zu schaffen; für den Bau von Schulen zu sorgen, war ihnen eine selbstverständliche Pflicht, zumal sich dies auch für die Industrie günstig auswirkte. Sparsam zu wirtschaften, Schulden möglichst zu vermeiden, diese Grundlage ihrer eigenen Unternehmensführung übertrugen sie auch auf die Verwaltung der Stadt. Die Förderung von Kunst und Wissenschaft war im 19. Jahrhundert noch keine Aufgabe der Städte, sondern des wohlhabenden Bürgertums. Dieses gab es aber in Bochum nicht. Daß die Bürgermeister durch Tod und Wahl in andere Städte häufiger wechselten, mag mit dazu beigetragen haben, daß die planmäßige äußere und innere Gestaltung der Stadt wie Greve sie begonnen hatte, vorerst nicht weitergeführt wurde.
Die heute zu Bochum gehörenden Vorortgemeinden hatten sich in derselben Zeit in sehr unterschiedlicher Weise entwickelt. Nur einige waren vom Bergbau unmittelbar nicht berührt worden. Den ländlichen Charakter der frühIndustriellen Zeit hatten vor allem Stiepel und Querenburg bewahrt, in dessen Gemarkung heute die Gebäude der Ruhr-Universität emporragen, da der Bergbau frühzeitig in diesem Gebiet zum Erliegen gekommen war oder nur noch von einigen mittleren Zechenbetrieben wurde. In starkem Maße gewachsen waren aber vor allem seit den 70er und 80er Jahren die Vororte im Norden und Osten der Stadt. Ihre Einwohnerzahl war zum Teil um das Zehn- bis Fünfzehnfache gestiegen. Selbst die größten von ihnen, wie Werne, Hamme mit mehr als 10 000 , Langendreer mit über 20 000 Einwohnern, waren aber nur verstädterte Industriegemeinden, deren Kennzeichen die ausgedehnten Schachtanlagen und Fördertürme waren. Siedlungsmäßig und baulich bildeten sie keine Einheit; vor allem die flächenmäßig ausgedehnten Gemeinden gliederten sich in mehrere, in ihrer Struktur sehr unterschiedliche Ortsteile, zwischen denen keine oder nur geringe, lockere Zusammenhänge bestanden. Abseits oder in unmittelbarer Nähe der älteren Siedlungen waren von den Bergwerksgesellschaften für ihre Bergleute “Kolonien” gebaut worden, zunächst einige wenige Häuser und Häusergruppen, dann ausgedehnte Straßenzüge. Im Süden der Stadt war es dagegen nur an einigen Stellen zu Koloniebildungen gekommen, da in diesem Bereich des alten Bergbaues neue, größere Schachtanlagen die älteren Stollenzechen ersetzt hatten, Bergleute infolgedessen in größerer Zahl zur Verfügung standen und die Zugewanderten in den von Einheimischen erbauten Häusern Unterkunft finden konnten. Die natürlichen Spannungen zwischen Einheimischen und Fremden traten in diesen zu Industriegemeinden gewordenen Bauernschaften und Dörfern, deren Bewohner in ihrer überwiegenden Mehrzahl aus Zugewanderten bestanden, um so stärker hervor, als sie sich mit gesellschaftlichen, kirchlichen und solchen der landschaftlichen Herkunft verbanden. Der einheimische Bergmann gehörte selbst-verständlich zur dörflichen Gemeinschaft, mit dem zugewanderten Bergmann kam er außerhalb der Arbeitszeit nicht zusammen. Den katholischen Bergleuten in der Kolonie standen die evangelischen Einheimischen Langendreer genauso ablehnend gegenüber wie den katholischen Eisenbahnern. Die gemeinsame Kirchengehörigkeit reichte nicht aus, um Unterschiede landschaftlicher Herkunft zu überwinden. Der evangelische Masure aus Ostpreußen war für die Einheimischen genauso ein Fremder wie der polnische Bergmann aus der Provinz Posen. Der Anteil der Zuwanderer aus den preußischen Ostprovinzen war beträchtlich – 20 bis 30 v.H. der Bevölkerung – nur in den Gemeinden, in denen seit den 90er Jahren neue Schachtanlagen abgeteuft, bestehende vergrößert worden waren. Eheliche Verbindungen gab es bis zum ersten Weltkrieg nur in seltenen Ausnahmefällen zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Erst ihre Kinder, die in der Industriegemeinde aufwuchsen, heirateten Angehörige einheimische Familien, wenn sie mit ihnen zusammen groß geworden waren, im gleichen Ortsteil lebten. Dies war vor allem der Fall, wenn sie selbst oder ihre Väter durch Hausbau Eigentum erworben hatten. Dorf und Kolonie fanden aber auch dann nicht zusammen. Da bis zum ersten Weltkrieg die Zuwanderungen anhielten, kam es immer wieder zu erneuten Spannungen. An der Verwaltung der Gemeinden hatten die zugewanderten Bergleute, die den Hauptteil der Bevölkerung stellten, nur einen geringen Anteil. Sie lag in den Händen der Einheimischen und der Zechen, die durch von ihnen entsandte Gemeindeverordnete einen maßgebenden, ja beherrschenden Einfluß auf die Gemeinden ausübten, die Gemeindelasten vornehmlich trugen. Von den an der Ruhr gelegenen Gemeinden, die seit 1885 zum Kreise Hattingen gehörten, abgesehen, blieb Bochum für alle diese Industriegemeinden die Stadt. Durch Straßenbahnlinien – die erste von Bochum nach Herne wurde 1894 eröffnet – wurden sie seit den 90er Jahren mit ihr verbunden. Betrieben wurden die Straßenbahnen von der 1896 gegründeten Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG, die heute das größte und leistungsfähigste Nahverkehrsunternehmen im ganzen Ruhrgebiet ist.
Mit der Jahrhundertwende setzte für Bochum eine neue Entwicklung ein.
Das “Gleisdreieck”, gebildet von der Bergisch-Märkischen Bahn im Süden, der Rheinischen Bahn im Norden und Nordosten sowie der Gußstahlstrecke im Westen, das zu Beginn der 70er Jahre die wachsende Innenstadt weit umspannt hatte, war inzwischen dicht bebaut. Bochum brauchte für seine ständig wachsende Bevölkerung neue Wohnbereiche. Wiemelhausen im Süden und Grumme im Norden waren mit ihren unmittelbar an die Stadt grenzenden Teilen kaum bebaut, während Hamme und das ihm benachbarte Hofstede baulich bereits mit der Stadt in starkem Maße verwachsen waren.
Wie die anderen Städte am Hellweg stand Bochum vor der Aufgabe, sein Stadtgebiet durch Eingemeindungen zu vergrößern und damit zugleich zu verhindern, daß in den Nachbargemeinden in unmittelbarer Nähe der Stadt Industriewerke gebaut wurden. Für die Eingemeindungen sprach, daß die Vorortgemeinden zum Teil bereits durch Wasser und Gaslieferungen von Teil Bochum abhängig waren. Ihnen entgegen stand deren Bestreben, selbständig zu bleiben, aber Anteil zu haben an den wirtschaftlichen und schulischen Vorteilen der Stadt, ohne zu ihren Lasten beitragen zu müssen. An der Spitze des Landkreises stand seit 1900 Karl Gerstein, “der letzte königliche Landrat des Kreises Bochum”, wie die selbst gewählte Grabinschrift lautet. Er war der bedeutendste in der Reihe der Bochumer Landräte von 1816 bis 1929, ein Verwaltungsfachmann von hohem Rang und Weitblick, der manche hohe Staatsstellung ausschlug, um das von ihm als Landrat begonnene Werk vollenden zu können. Nicht in umfangreichen Eingemeindungen durch die Städte sah er eine Lösung der im wachsenden Industriegebiet vorhandenen Schwierigkeiten auf gemeindlichem Gebiet, sondern in der übergemeindlichen Zusammenarbeit im Kreise und über den Kreis hinaus. Er und der Essener Oberbürgermeister Zweigert waren die Gründer der Emschergenossenschaft, deren Satzung weitgehend auf seinen Gedanken beruhte, Städte, LandGemeinden und Industriewerke in gemeinsamer Arbeit zusammenzuführen. Um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gemeinden von Bochum zu wahren, gründete er 1902 mit dem Gelsenkirchener Landrat das Verbandswasserwerk, 1909 zur besseren verkehrsmäßigen Erschließung des Kreisgebietes die Westfälische Straßenbahn GmbH; ihr Netz wurde 1929 mit dem der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen vereint. War es in diesen Fällen sein Bestreben, die Unabhängigkeit der Gemeinden gegenüber dem Übergewicht der großen Städte zu wahren, so arbeitete er mit den Landräten der Nachbarkreise, der Stadt Bochum und den großen BergBauunternehmen des Kreises zusammen, als er 1906 mit der AEG unter Rathenau und der Berliner Handelsgesellschaft die Elektrizitätswerke Westfalen in Bochum gründete, um erstmals in einer planmäßigen Verbundwirtschaft die überschüssigen Energien der Elektrizitätserzeugung der Bergwerke zugunsten der Städte und Landgemeinden auszunutzen. Sein persönlicher, erst nachträglich vom Kreistag genehmigter Entschluß war es, 1909 gemeinsam mit den Landräten von Recklinghausen und Gelsenkirchen die in den Händen der AEG und der Banken liegende Aktienmehrheit zu erwerben, das Elektrizitätswerk Westfalen, eines der Rechtsvorgänger der heutigen Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen (VEW), zu einem kommunalen Unternehmen zu machen, um dadurch beim Ausbau des Leitungsnetzes die Belange der Landgemeinden besser berücksichtigen zu können. Er war bemüht, den Landkreis in seinem alten Umfang zu erhalten, aber er verschloß sich Notwendigkeiten nicht, wenn sie einer größeren Einheit nützten. Die Bochumer Eingemeindungen des Jahres 1904 hat er deshalb maßgeblich gefördert. Durch die Eingemeindungen wurde Bochum zur Großstadt im statistischen Sinne, ohne wirklich Großstadt zu sein. Trotz mancher Um- und Neubauten zeigten die engen Straßen der Altstadt noch immer die kleinstädtischen Züge des 19. Jahrhunderts. Uneinheitlich in ihren Bauten waren die neuen Geschäftsstraßen; moderne Geschäftshäuser standen neben Bauten der Gründerjahre kleineren unscheinbaren aus den 60er Jahren. Die Fehler und Mängel der Vergangenheit wollte man bei der Erschließung der neuen Stadtteile vermeiden. Planmäßig wurden in dem an das alte Stadtgebiet im Süden unmittelbar anschließende Ehrenfeld die Straßen angelegt, Plätze für Verwaltungsgebäude, Kirchen und Schulen freigehalten. Ein beträchtlicher Teil des Rechener Busches blieb erhalten, wurde zum Südpark umgestaltet. Ein neuer Stadtteil entstand in wenigen Jahren, der bald im allgemeinen Bewußtsein einen Teil der Stadt bildete. Mit der Neugestaltung einzelner kleiner
Bereiche in der Innenstadt wurde begonnen. Die Vorarbeiten für einen einheitlichen, die gesamte Stadt umfassenden Bebauungsplan waren fast vollendet, als der erste Weltkrieg ausbrach.
Die Arbeiterschaft bildete 1870 wie 1914 den Hauptteil der Bevölkerung; ihr Anteil war durch die Eingemein-dungen der beiden Bergbaugemeinden Hamme und Hofstede noch gewachsen! Innerhalb der Arbeiterschaft zeigten sich aber bereits deutliche Unterschiede, bedingt durch die Verschiedenheit der Berufe. Aus Einheimischen und Zugewanderten, vornehmlich aus dem Paderborner Gebiet, dem Sauerland und Hessen hatte sich seit den 70er Jahren eine breite mittelständische Schicht von Handwerksmeistern, Kaufleuten, kleineren Gewerbetreibenden gebildet; Beruf und gleiche Kirchenzugehörigkeit hatten sie vornehmlich zusammengeführt.
Gewachsen war der Kreis der kaufmännischen Angestellten, der Werkmeister, der Ingenieure beim Bochumer Verein, den Zechen. Aus Handwerksbetrieben entwickelten sich allmählich mittlere Unternehmen als Zulieferer der Schwerindustrie, insbesondere des Bergbaues. Durch das Amts- und Landgericht, durch die großen kirchlichen und berufsgenossenschaftlichen Krankenhäuser – wie Bergmannsheil – war die Zahl der Angehörigen akademischer Berufe, die durch Ausbildung und Beruf den Künsten und Wissenschaften aufge-schlossener gegenüberstanden, größer geworden. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit der höheren Schulen wirkte sich aus. Um die Jahrhundertwende war eine Generation herangewachsen, die sich anders als ihre Väter, die der Arbeit wegen in die Stadt gekommen waren, Bochum als Heimatstadt innerlich verbunden fühlte, stolz auf sie war, nicht wollte, daß Bochum den anderen großen Städten zurückstand.
In diesem “besseren Kreisen”, wie sie in amtlichen Berichten genannt wurden, hatte der 1860 als Gesangverein gegründete Musikverein seine Mitglieder. Mit viel Idealismus bemühte er sich von Anfang an durch Aufführung von Chor- und Orchesterkonzerten um das Musikleben der Stadt; in seinen finanziellen Mitteln war er aber begrenzt; es fehlten die wohlhabenden Gönner und Mäzene, die bereit waren, den Fehlbetrag eines Konzertes zu decken. Orchesterkonzerte zu veranstalten, war dadurch erschwert, daß es ein leistungsfähiges gutes Orchester in Bochum nicht gab. Die kleine, aus Berufsmusikern gebildete “Städtische Kapelle” war ein Privatorchester, dessen Mitglieder häufig wechselten. Ungünstig wirkte sich auch aus, daß es in Bochum keine geeigneten Säle für Konzerte und Theateraufführungen gab. Für ein selbständiges Theaterunternehmen waren bis zur Jahr-hundertwende die Voraussetzungen in Bochum nicht gegeben. Auswärtige Theaterdirektoren, insbesondere Dortmunder, spielten mit ihrer Truppe regelmäßig in den Wintermonaten in Bochum. Daß die Aufführungen in einem Gastwirtschaftssaal stattfanden, der zwar “Stadttheater” genannt wurde, aber vielerlei Zwecken diente, trug dazu bei, daß viele aus den “besseren Kreisen”, die gerne eine gute Aufführung besuchten, lieber nach Dortmund oder Essen zum Theater fuhren. Eine Möglichkeit, die Theaterverhältnisse zu verbessern, insbesondere durch verbilligte Vorstellungen die Arbeiterschaft zu einem Theaterbesuch anzuregen, sah man in den 90er Jahren in staatlichen Zuschüssen. Daß die Stadt selbst Zuschüsse zahlen, nach dem Beispiel anderer Städte die Saaalmiete, die Heizungs- und Beleuchtungskosten übernehmen könne, daran dachte man zunächst nicht. Erstmals im Jahre 1900 wurde dem Dortmunder Theaterdirektor ein Zuschuß von 1 000 Mark gewährt. Nach den Eingemeindungen von 1904 wurden sich aber Magistrat und Stadtverordnete der Verpflichtungen bewußt, die einer Großstadt auf kulturellem Gebiet erwuchsen, wenn sie neben anderen Großstädten bestehen wollte. Die Zuschüsse für Theateraufführungen wurden erhöht, 1910 betrugen sie 4 500 Mark. Dem Musikverein wurden seit dem Jahre 1905 regelmäßig Beihilfen gewährt, um größere Konzerte durchführen zu können. Erhöht wurden auch die Zuschüsse an den Dirigenten der “Städtischen Kapelle”, damit es ihm möglich war, gute Musiker langfristig zu verpflichten. In der Bürgerschaft regte sich der Wille, selbst etwas für ein gutes Theater zu tun. 1911 wurde ein Theaterverein gegründet. Die Stadt entschloß sich zum Handeln, als 1912 das im Ehren-feld bestehende Unterhaltungs- und Varietétheater in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Sie erwarb da Gebäude im Jahre 1914 und baute es zu einem Theater um. Am 30. Dezember 1915 konnte das Bochumer Stadttheater eröffnet werden. Mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und dem Essener Stadttheater wurden Gastspielverträge abgeschlossen. Die Verhandlungen führte Wilhelm Stumpf. Seitdem er 1904 Stadtrat seiner Vaterstadt geworden war, hatte er sich neben den anderen umfangreichen Aufgaben seines Dezernates vor allem für die Förderung aller kulturellen Bestrebungen eingesetzt. Sein Ziel blieb, wie in den anderen Städten, ein eigenes Theater unter eigener Leitung mit eigenem Personal zu schaffen, wie er auch seit 1910 bestrebt war, ein eigenes städtisches Orchester zu gründen. Beides wurde verwirklicht, als 1919 Saladin Schmitt zum ersten Intendanten und Rudolf Scholz-Dornburg zum ersten Musikdirektor der Stadt berufen wurden.
Mit dem ersten Weltkrieg endete wie im gesamten Ruhrgebiet auch für Bochum und seine Vororte die Zeit des schnellen, durch die Industriealilsierung bedingte Wachstums. Der Weltkrieg, die Unruhen und Streiks der ersten Nachkriegsjahre, die dadurch bedingten Störungen des Wirtschaftslebens hemmten die Entwicklung der Stadt. Die französische Besetzung, Der Ruhrkampf, die mit ihm verbundene Geldentwertung und Arbeitslosigkeit setzten allen Planungen ein vorläufiges Ende. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Stadt blieben aber unzerstört. Als Fritz Graff, der seit 1900 als Oberbürgermeister die Voraussetzungen für die Entwicklung Bochums zur Großstadt geschaffen hatte, 1925 sein Amt niederlegte, bestand die Aussicht, die alten Pläne unter günstigeren wirtschaftlichen Voraussetzungen zu verwirklichen. Die gemeindliche Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes stellte seinem Nachfolger Otto Ruer die Aufgabe, in Auseinandersetzung mit dem Bestreben der benachbarten Großstädte, Stadtgebiet und Einflußbereich Bochums zu vergrößern. Ver-glichen mit Essen und Dortmund, die im Bereich der alten gleichnamigen Landkreise als einzige große Städte die natürlichen verwaltungsmäßigen und kulturellen Mittelpunkte für alle Gemeinden geblieben waren, war Bochum ungünstiger gestellt. Witten im Süden, Gelsenkirchen im Nordwesten des Kreises waren selbst frühzeitig Mittelpunkte industrieller Entwicklung und Städte von ausgeprägter Eigenart geworden; als Kreisstadt setzte Gelsenkirchen dem Bochumer Einflußbereich eine Grenze. Den Eingemeindungsabsichten der Stadt stand das Streben der größeren Industriegemeinden wie Gerthe und Langendreer entgegen, die als Mittelstädte selbständig werden wollten. Die Eingemeindungen von 1926 und 1929, durch die das Stadtgebiet, das 1903 nur 621 ha umfaßt hatte, von 2819 ha auf 12 137 ha vergrößert wurde, erfüllten nicht aller Erwartungen der Stadt. Der größte Teil des ehemaligen Landkreises Bochum wurde zwar in die Stadt eingemeindet. Im Süden gewann Bochum im Ruhrtal und seinen Hängen ausgedehnte neue Siedlungsgebiete. Wattenscheid, Eickel und Wanne in die Stadt einzugliedern, damit den seit dem Beginn des Jahrhunderts erstrebten Anschluß an das Kanalnetz zu erhalten, gelang jedoch nicht. Sie blieben wie Herne als selbständige Mittelstädte der Stadt vorgelagert.
Das neue Bochum mit seinen teils noch ländlichen, teils verstädterten Vororten, deren uneinheitliches SiedlungsGebiet noch das schnelle, oft zufallsbedingte Wachsen der industriellen Anfangszeit deutlich erkennen ließ, war eine Stadt der Schwerindustrie, bestimmt durch Kohle und Eisen. Der Bochumer Verein war das größte Unter-nehmen der Stadt geblieben. Von seinen 17 000 Beschäftigten innerhalb und außerhalb Bochums arbeiteten allein fast 10 000 in den verschiedenen Werkanlagen der Gußstahlfabrik. Ihre Belegschaft war größer als die aller anderen Stahl- und Hüttenwerke, Maschinenfabriken der Stadt insgesamt. An erster Stelle hinsichtlich der Beschäftigtenzahl stand aber nunmehr der Bergbau. Nächst Gelsenkirchen war Bochum die zechenreichste Stadt des Ruhrgebietes. 50 000 Menschen arbeiteten 1929 auf den 74 Schachtanlagen im Bochumer Stadtgebiet, die 18 Bergwerksgesellschaften gehörten. Bochum konnte sich um so mehr mit Recht eine Stadt des Bergbaues nennen, als einige der großen bergbaulichen Organisationen ihren Sitz in der Stadt hatten: die Ruhrknappschaft, die Knappschaftsberufsgenossenschaft, der Benzolverband und das Stickstoffsyndikat, insbesondere aber auch der Verband der Bergbauindustriearbeiter, der einstige “Alte Verband”. Die Berggewerkschaftskasse mit ihren Einrichtungen., insbesondere die Bergschule, war über das Ruhrgebiet hinaus durch ihre Forschungen und Leistungen weit bekannt.
Eine rege Bautätigkeit ließ seit der Mitte der 20er Jahre die Innenstadt nach Norden und Süden wachsen; größere Siedlungen und Wohnbereich entstanden am Rande des alten Stadtgebietes sowie in den Vororten. Neue Verwaltungs- und Behördenbauten in größerer Zahl, das Finanzamt 1925, die Städtische Sparkasse und das Polizeipräsidium 1929, das neue Hauptpostamt 1925 – 1932, bekundeten ebenso wie die modernen Schulen, daß Bochum begann, auch in baulicher Hinsicht eine moderne Großstadt zu werden. Als 1931 das neue Rathaus, dessen Neubau 1926 begonnen worden war, eingeweiht wurde, hatte die Wirtschaftskrise eingesetzt. Sie lähmte das Wirtschaftsleben der Stadt. Mehr als die Hälfte derer, die 1929 im Bergbau, in der eisenschaffenden und eisenverarbeitenden Industrie, im Baugewerbe tätig gewesen waren, waren 1932 erwerbslos. Erst allmählich konnten sie in den folgenden Jahren in das Erwerbsleben wieder eingegliedert werden. Seine alte Bedeutung als Arbeitgeber hat der Bergbau in Bochum nicht wieder erlangt. Etwa 33 000 Beschäftigte gab es vor dem Ausbruches zweiten Weltkrieges im Bochumer Bergbau, ebenso viele in den Unternehmungen der Eisenerzeugung und Eisenverarbeitung; es waren mehr als die Hälfte aller in der Stadt gezählten Erwerbstätigen.
Trotz aller finanziellen Schwierigkeiten, die sich in Notjahren durch die großen Ausgaben zugunsten der Arbeitslosen und Hilfsbedürftigen ergaben, die geldliche Mittel der Stadt in hohem Maße beanspruchten, hat die Stadt an der Förderung von Kunst und Kultur, die vor dem ersten Weltkrieg begonnen hatte, festgehalten, obwohl seit 1919 die gesamten Ausgaben zugunsten von Theater, Orchester, Museen und Bücherei allein von der Stadt aufzubringen waren. Als 1927 die Shakespeareschen Königsdramen in einem Zyklus anläßlich der Tagung der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft auf der Bochumer Bühne aufgeführt wurden, 1928, von der Stadt und der Goethe-Gesellschaft gemeinsam veranstaltet, eine Woche “Goethe auf dem Theater” folgte, gewann Bochum, das bisher nur durch seine industriellen Erzeugnisse und die Bergschule weithin bekannt gewesen war, auch im Bereich von Kunst und Wissenschaften einen Namen. Ein bisher unbekanntes Provinztheater reihte sich ein in den Kreis der großen, anerkannten Bühnen. Es war die Leistung Saladin Schmitts. Als er kurz nach Beginn seiner Bochumer Tätigkeit geneigt war, einem Ruf nach Mannheim zu folgen, hat Wilhelm Stumpf, der gute Geist des Bochumer Theaters, wie er genannt wurde, ihn vor die Frage gestellt, ob er eine Tradition fortsetzen oder eine neu begründen wolle. Saladin Schmitt blieb. Mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Mittel hatte die Stadt bewußt darauf verzichtet, ein normales Stadttheater mit Oper, Operette und Schauspiel aufzubauen. Schmitt und Stumpf stimmten darin überein, daß durch die Beschränkung auf das Schauspiel allein künstlerische Leistungen von hohem Rang möglich seien. Die notwendige Ergänzung bot seit 1921 die Duisburger Oper. Die Theatergemeinschaft der beiden selbständigen Bühnen war dadurch möglich, daß Schmitt beide als Intendant leitete. Sie beruhte auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit der beiden für das Kulturleben ihrer Städte verantwortlichen Männer, des Oberbürgermeisters Jarres in Duisburg und Stadtrats Stumpf in Bochum. Als diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren, endete 1934 die Theatergemeinschaft. Die Bochumer Theaterwochen, wie die Schillerwoche 1934, die Kleistwoche 1926, die zweite Shakespearewoche 1937, im Spielplan der vorhergehenden Jahre sorgfältig vorbereitet, zogen kunstverständige Besucher aus dem gesamten Reichsgebiet und aus dem Ausland nach Bochum, zumal sie zum Teil mit wissenschaftlichen Tagungen verbunden waren. In Bochum selbst fanden die künstlerischen Leistungen zunächst nur geringen Beifall. Ein Theater, das vornehmlich der Unterhaltung und Entspannung diente, wäre vielen Bochumern lieber gewesen. Ein Publikum mußte erst allmählich herangebildet werden. Mit dem äußeren Erfolg stellte sich auch in Bochum Anerkennung ein. Die Bochumer wurden stolz auf die Leistungen ihres Schauspiels.
STUMPFS Fürsorge galt in gleicher Weise dem Orchester, das schon früher gleichzeitig Gastkonzerte in den benachbarten Städten gab. Für ein Kunstmuseum von Rang fehlten die Mittel und die Mäzene in der Bürgerschaft. Die Bochumer mußten sich deshalb mit einer kleinen Kunstsammlung bzw. mit regelmäßigen Ausstellungen begnügen. Eine wirkliche Großtat war die gemeinsame Gründung des Bergbaumuseums von Stadt und Berggewerkschaftskasse. Fritz Heise, Direktor der Bochumer Bergschule, hatte die ersten Anregungen dazu gegeben. Die Stadt kam ihrem Ziel, in der Reihe der großen Städte des Ruhrgebiets eine entsprechende Stellung zu haben, langsam näher. Ihm diente auch die Gründung der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Industriebezirk mit den Teilanstalten in Dortmund, Duisburg, Hagen (Westf.) und Recklinghausen hervorging. Die politischen Ereignisse des Jahres 1933 setzten Ruers erfolgreichem Wirken für die Stadt ein vorzeitiges Ende. Was er in den wenigen Jahren geschaffen hatte, blieb aber auch in der Folgezeit bestehen.
Die großen Zerstörungen des Kriegesboten die Möglichkeit, Bochum nach modernen Grundsätzen wieder aufzubauen. Unmittelbar nach der Währungsreform 1948 wurde der planmäßige Aufbau der ganzen Stadt von den Stadtverordneten beschlossen. Es war ein kühner Entschluß, unabhängig von den alten Straßenführungen aus der verbauten Innenstadt der Vorkriegszeit eine moderne Verwaltungs- und Geschäftsstadt zu schaffen, sie durch einen breiten Straßenring zu begrenzen, durch große Straßen zu erschließen. Neue, aufgelockerte Siedlungen verbinden sie nunmehr mit den Vororten, die selbst baulich gewachsen sind. Moderne Bauten: der Hauptbahnhof, das Stadtwerkehochhaus, Banken, Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser kennzeichnen heute die Innenstadt, in der nur die beiden wiederhergestellten alten Kirchen an die Vergangenheit erinnern. Die zerstörten Schulen, das Schauspielhaus, Stadtbücherei und Verwaltungsakademie wurden wieder aufgebaut; die Voraussetzungen für das kulturelle Leben in der erneuerten Stadt waren damit geschaffen. Eine Kunstgalerie wurde als Sammlungsstätte moderner Kunst gegründet.
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Wiederaufbau zu sichern war die wichtigste Aufgabe der Nachkriegszeit. Einmütig setzen sich die Stadtverordneten für die Erhaltung der von der Demontage bedrohten Werke ein; erst zu Beginn der 50er Jahre war diese Gefahr behoben. Eisenerzeugung und –verarbeitung nahmen wie in der Vorkriegszeit wieder die erste Stelle im Bochumer Wirtschaftsleben ein, an zweiter folgte der Bergbau. Die großen Maschinenbauunternehmen, als Zulieferer der Bergbaues entstanden, waren jedoch nicht mehr völlig von ihm abhängig; für einen beträchtlichen Teil ihrer Erzeugnisse hatten sie Abnehmer in anderen Wirtschaftszweigen und im Ausland gefunden. Um die durch die Schwerindustrie einseitig bestimmte Wirtschaftsstruktur zu verbessern, das Wirtschaftsleben Bochums zugleich weniger krisenfällig zu machen, war die Stadt die Erfolg bemüht, mittlere und kleinere Unternehmen anzusiedeln. Daß die Bochumer Zechen noch jahrzehntelang bestehen würden, konnte die Stadt bei ihren Planungen mit Sicherheit annehmen. Leistungsfähige Groß- und Zentralschachtanlagen wurden an Stelle veralteter Schächte in Betrieb genommen, das Großkraftwerk Springorum gebaut, um den südlichen Zechen den Absatz auf lange Zeit hin zu sichern. Unerwartet traf daher 1959 die Stadt der Entschluß der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, ihre Schachtanlagen im Bochumer Raum stillzulegen. Weitere Stillegungen folgten. Von den 17 Schachtanlagen des Jahres 1957 arbeitet heute keine mehr. Der Bau der Opel-Werke auf ehemaligem Zechemgelände, die 1962 mit der Fabrikation begannen, ist ein deutliches Zeichen für den industriellen Wandel der Stadt; nächst dem Bochumer Verein sind sie heute ihr größtes Unternehmen. Ihre Ansiedlung zu ermöglichen, ihren Bürgern damit Arbeitsplätze zu schaffen, war die Stadt zu großen Vorleistungen bereit.
Der Beschluß des Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen am 18. Juli 1961, die erste neue Universität des Landes Bochum zu errichten, wurde von Stadt und Bürgerschaft als Anerkennung für die Aufbauarbeit nach 1945 empfunden, als Anerkennung aber auch für das jahrzehntelange Bestreben, aus der Stadt der Arbeit des 19. Jahrhunderts eine wirkliche Großstadt zu machen. Die Ruhr-Universität, die 1965 eröffnet wurde, läßt nicht nur im alten Bergbaugebiet nördlich der Ruhr einen neuen Stadtteil entstehen, das kulturelle Leben der Stadt vielseitiger werden. Bochum bietet sich damit die Möglichkeit, in der Verbindung von moderner Industrie- und Universitätsstadt unter den Städten des sich wandelnden Industriegebietes einen besonderen, allein ihm eigentümlichen Rang einzunehmen.
1985 Bochumer Heimatbuch
Band 8
Herausgegeben von der Vereinigung für Heimatkunde Bochum e.V.
Verlag:
Schürmann & Klagges
Titelbildgestaltung:
„Schorsch-Design®" Georg Wohlrab, Heusnerstraße 17, Bochum
Gesamtherstellung:
Druckhaus Schürmann & Klagges,
Bochum ISBN-Nr. 3-920612-06-X